Was auf Mittelständler zukommt – und wie sie sich vorbereiten
Das Telefon klingelt. Am anderen Ende ein frustrierter Geschäftsführer: „Zwei unserer Sachbearbeiterinnen im Vertrieb machen quasi die gleiche Arbeit. Beide betreuen Bestandskunden, beide haben ähnliche Erfahrungen. Aber die eine verdient 600 Euro mehr im Monat. Die andere hat jetzt gefragt: „Meine Kollegin bekommt mehr Gehalt für die gleiche Arbeit – warum? ”Was sage ich ihr?“
Meine Gegenfrage: „Können Sie den Unterschied objektiv begründen?“ Langes Schweigen. Dann: „Naja, die eine war einfach besser im Verhandeln damals.Und die andere hat nie nach mehr gefragt.“
Genau solche Situationen werden ab Mitte 2026 zum Problem. Denn mit der verschärften EU-Entgelttransparenzrichtlinie 2023/970 reicht „der oder die war besser im Verhandeln“ nicht mehr als Begründung. Unternehmen müssen künftig objektive, nachvollziehbare Kriterien für Gehaltsunterschiede haben oder sie angleichen.
Die gute Nachricht: Wer jetzt anfängt, hat noch Zeit für eine strukturierte Vorbereitung. Wer wartet, wird 2026 unter Druck geraten.
Für Eilige: Das Wichtigste in Kürze
- Alle Unternehmen – unabhängig von der Größe – müssen künftig transparenter mit Entgelten umgehen. Das gilt sowohl im Bewerbungsprozess als auch für Anfragen von Mitarbeitern, die wissen wollen, wie ihre Bezahlung im Vergleich aussieht.
- Firmen mit mehr als 100 Beschäftigten haben zusätzlich eine Berichtspflicht: Sie müssen regelmäßig offenlegen, wie ihre Gehaltsstrukturen aussehen und wo ihr Gender Pay Gap liegt (durchschnittlicher Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen). Besteht eine Lohnlücke von über fünf Prozent, die nicht objektiv begründet werden kann, sind sie verpflichtet, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
- Wer gegen die Vorgaben verstößt, riskiert spürbare Bußgelder – wie hoch genau, steht noch nicht fest, aber sie sollen „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend” (Quelle: EU-Richtlinie 2023/970, Art. 23) sein. Wiederholte Verstöße können sogar zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen. Im Streitfall müssen Arbeitgeber beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt.
Gehaltstransparenz beginnt schon beim Recruiting
Eine der größten Änderungen durch das neue Entgelttransparenzgesetz betrifft den Bewerbungsprozess: Ab Mitte 2026 müssen Unternehmen im Bewerbungsprozess klare Gehaltsangaben machen – entweder direkt in der Ausschreibung oder spätestens vor dem ersten Gespräch.
Muss ich ab 2026 in jede Stellenanzeige ein Gehalt schreiben?
Nicht zwingend direkt in die Anzeige, aber spätestens vor Abschluss des ersten Auswahlgesprächs müssen Sie Bewerbern die Einstiegsvergütung oder eine Gehaltsspanne mitteilen. Eine Frage nach dem bisherigen Gehalt ist unzulässig.
Was bedeutet das konkret?
Wenn Sie etwa einen Vertriebsleiter suchen, könnten Sie in die Anzeige schreiben:
„Gehalt: 65.000–80.000 Euro, abhängig von Qualifikation und Erfahrung.“
Alternativ können Sie die Angabe auch erst im ersten Telefonat machen.

Der Auskunftsanspruch für Mitarbeiter wird deutlich ausgeweitet
Der Entgelttransparenzgesetz Auskunftsanspruch war bisher begrenzt: Das Gesetz von 2017 gibt Mitarbeitern in Unternehmen ab 200 Beschäftigten das Recht, nach Vergleichsgehältern zu fragen. Ab 2026 gilt das für alle Unternehmen, unabhängig von der Größe.
Wie schnell muss ich auf eine Gehaltsauskunft reagieren?
Sie haben zwei Monate Zeit, auf solche Anfragen zu antworten.
Das wirkt auf den ersten Blick großzügig,kann aber knapp werden, wenn die Gehaltsdaten an verschiedenen Stellen liegen. In vielen Betrieben sind Teile in Excel abgelegt, anderes in der Lohnbuchhaltung oder im ERP-System. Je besser die Informationen gebündelt sind, desto leichter wird die Antwort.
Was ich in Projekten immer wieder erlebe: Unternehmen denken, sie kennen ihre Gehaltsstruktur. Bei einer ersten Gap-Analyse kommen oft Strukturen ans Licht, die historisch gewachsen sind und bisher kaum beachtet wurden. Solche Unterschiede sind nichts Ungewöhnliches, gerade deshalb kann die Analyse ein hilfreicher Anlass sein, Gehaltsdaten transparenter und übersichtlicher zu machen.

Entgelttransparenzgesetz 2026 – Berichtspflicht
Unternehmen müssen regelmäßig einen Entgelttransparenzbericht erstellen und den zuständigen Behörden übermitteln oder zur Veröffentlichung bereitstellen, je nach nationaler Umsetzung. Darin müssen sie Gehälter offenlegen und die Höhe des Gender Pay Gaps (Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen auf einer vergleichbaren Position) in ihrem Unternehmen.
Ab wie vielen Mitarbeitern gilt die Berichtspflicht beim Entgelttransparenzgesetz?
- Unter 100 Mitarbeiter: Keine Berichtspflicht, aber Auskunftspflicht bei Anfragen
- 100 bis 149 Mitarbeiter: Bericht alle drei Jahre, erstmals bis zum 07. Juni 2031
- 150 bis 249 Mitarbeiter: Bericht alle drei Jahre, erstmals bis 7. Juni 2027
- Ab 250 Mitarbeiter: Jährlicher Bericht, erstmals bis 7. Juni 2027 auf Basis der Daten von 2026
Gender-Pay-Gap von über 5 Prozent
Was passiert, wenn der Bericht einen Gender-Pay-Gap von über 5 Prozent zeigt, der nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien begründet werden kann?
Erstens: Das Unternehmen muss innerhalb von 6 Monaten eine gemeinsame Entgeltbewertung durchführen, zusammen mit dem Betriebsrat oder der Arbeitnehmervertretung. Das bedeutet: systematisch analysieren, wo die Unterschiede herkommen und wie man sie beseitigen kann.
Zweitens: Es drohen Sanktionen. Die genaue Höhe steht noch nicht fest, aber die EU denkt an empfindliche Bußgelder.
Drittens: Bei Rechtsstreitigkeiten gilt die Beweislastumkehr. Das heißt: Wenn ein Mitarbeiter glaubt, er werde aufgrund seines Geschlechts schlechter bezahlt, muss der Arbeitgeber beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt.
Aus meiner Beratungspraxis kann ich sagen: In acht von zehn Unternehmen finden wir bei der ersten Analyse Lücken, die nicht objektiv begründbar sind. Meistens nicht aus böser Absicht, sondern weil Gehälter historisch gewachsen sind. Der eine hat gut verhandelt, die andere nie nachgefragt. Das war jahrelang kein Problem, aber mit dem neuen Entgelttransparenzgesetz wird es eines.
Welche objektiven Kriterien rechtfertigen Gehaltsunterschiede?
Das ist die Frage, die mir in jedem Gespräch gestellt wird: „Welche Kriterien kann ich eigentlich heranziehen?“ Jahrelang haben viele Mittelständler Gehälter „nach Gefühl“ oder in Einzelverhandlungen festgelegt. Jetzt braucht es Systematik.
Die Richtlinie gibt vier Kriterien vor:
- Kompetenzen: Benötigt man für die Ausübung dieser Stelle einen Hochschulabschluss, eine Berufsausbildung oder Zusatzqualifikationen? Wie viele Jahre Erfahrung bringt jemand mit – allgemein und in der aktuellen Rolle? Gibt es nachweisbare Fähigkeiten, die für die Position relevant sind?
- Belastungen: Wie hoch ist die mentale, psychosoziale und körperliche Beanspruchung in der Tätigkeit? Wird häufig unter Zeitdruck gearbeitet oder müssen komplexe Entscheidungen getroffen werden?
- Verantwortung: Führt jemand Mitarbeiter? Wie viele? Trägt jemand Budget- oder Projektverantwortung?
- Arbeitsbedingungen: Wie sind die Rahmenbedingungen des Arbeitsalltags gestaltet? Gibt es Aufgaben, Arbeitsmittel, Abläufe und Umwelteinflüsse, die das Arbeiten erleichtern oder erschweren (z. B. flexible Arbeitszeiten, ergonomischer Arbeitsplatz, Lärm, Schichtarbeit, hohe Temperaturen etc.)?
Wichtig ist: Diese Kriterien müssen vom Unternehmen dokumentiert und konsequent angewendet werden. Es reicht nicht zu sagen: „Der verdient mehr, weil er einfach besser ist.“ Die Personalabteilung muss konkret machen können, worin diese Leistung messbar besteht.
Mein Tipp: Nicht mit Perfektion starten. Sinnvoll ist es, zunächst fünf bis sieben Kernkriterien festzulegen, die zum Unternehmen passen, und diese konsequent anzuwenden. Besser einfach und klar – als zu komplex und am Ende nicht praktikabel.
Was tun, wenn bestehende Gehaltsunterschiede nicht zu rechtfertigen sind?
Diese Frage taucht fast immer auf, sobald die erste Gap-Analyse vorliegt. Typisches Beispiel: Zwei Mitarbeiter machen die gleiche Arbeit, haben ähnliche Qualifikationen – aber einer verdient 300 Euro mehr, weil er vor drei Jahren mit einem externen Angebot eine Gehaltserhöhung durchgesetzt hat.
Ist das noch okay? Nach bisheriger Praxis vielleicht. Nach dem neuen Transparenzgebot nicht mehr. Lässt sich ein Unterschied nicht mit objektiven Kriterien begründen, muss eine Angleichung erfolgen.
Heißt das, ich muss alle Gehälter auf das höchste Niveau anheben?
Nein. Wichtig ist, nachvollziehbare Unterschiede zu schaffen. Höhere Gehälter lassen sich etwa durch mehr Verantwortung, längere Berufserfahrung oder eine seltene Spezialisierung begründen. Eine höhere Bezahlung allein aufgrund besserer Verhandlung in der Vergangenheit reicht künftig nicht mehr.
Die Realität ist: Das kostet Geld. Aber deutlich weniger als eine spätere Klage mit Nachzahlung und Zinsen.

Schritt für Schritt zur Gehaltstransparenz
Seit über 20 Jahren begleite ich Unternehmen durch Veränderungen – inzwischen mehr als 200. Aus diesen Erfahrungen habe ich einen Fahrplan entwickelt, der in der Praxis funktioniert. Die wichtigsten Schritte:
Schritt 1: Saubere Datenbasis schaffen
Personaldaten liegen oft verstreut: ein Teil in der Lohnbuchhaltung, ein Teil in Excel, ein Teil im ERP-System. Ohne zentrale Übersicht über alle Gehälter – verknüpft mit Position, Qualifikation, Berufserfahrung und Geschlecht – lassen sich weder Gap-Analysen durchführen noch Auskunftsanfragen beantworten.
Für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern reicht Excel in der Regel nicht mehr aus. Hier lohnt sich die Investition in eine professionelle HR-Software mit Auswertungsfunktion. Die Kosten sind gering im Vergleich zu möglichen Sanktionen bei fehlerhafter oder verspäteter Berichterstattung.
Schritt 2: Objektive Gehaltskriterien definieren
Eine „gleichwertige Tätigkeit“ braucht klare, nachvollziehbare Kriterien. Sinnvoll sind fünf bis sieben Faktoren – etwa Ausbildung, Berufserfahrung, Verantwortungsbereich, Spezialkenntnisse oder Marktvergütung. Diese Systematik sollte für alle Positionen einheitlich angewendet und schriftlich dokumentiert werden.
Das schafft Transparenz für Gehaltsentscheidungen und dient als Grundlage für künftige Verhandlungen sowie für Auskunftsanfragen. Empfehlenswert ist zudem, den Betriebsrat frühzeitig einzubinden, um Akzeptanz und Klarheit zu sichern.
Schritt 3: Gap-Analyse durchführen
Im nächsten Schritt sollten Unternehmen den Gender Pay Gap berechnen. Verglichen wird dabei der durchschnittliche Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern in vergleichbaren Tätigkeiten.
Die EU schreibt dafür zwei Berechnungen vor:
1. Durchschnittlicher Gender Pay Gap
Hier wird berechnet, wie viel Prozent Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer – bezogen auf das Durchschnittsgehalt der Männer:
Formel:
(Durchschnittsgehalt Männer – Durchschnittsgehalt Frauen) ÷ Durchschnittsgehalt Männer × 100 %
Beispiel:
Verdienen Männer im Schnitt 4.000 €, Frauen 3.600 €, ergibt sich:
(4.000 – 3.600) ÷ 4.000 × 100 % = 10 % Gender Pay Gap
2. Mittlerer Gender Pay Gap (Median)
Hier wird geschaut, wie das mittlere Einkommen (Median) der Männer und Frauen aussieht – also das Gehalt, bei dem jeweils 50 % darüber und 50 % drunter liegen. Diese Kennzahl ist weniger anfällig für Ausreißer (z. B. einzelne sehr hohe Gehälter).
Formel:
(Median Männer – Median Frauen) ÷ Median Männer × 100 %
Beispiel: Verdienen Männer im Median 4.000 €, Frauen 3.400 €, ergibt sich:
(4.000 – 3.400) ÷ 4.000 × 100 % = 15 % Gender Pay Gap (Median)
In welchen Gruppen wird verglichen?
Die Berechnung erfolgt nicht einfach auf das ganze Unternehmen, sondern innerhalb vergleichbarer Tätigkeiten – also z. B.:
- Sachbearbeiter:innen Kundenservice
- Fachkräfte in der IT
- Teamleitungen Produktion
Entscheidend ist: gleiche oder gleichwertige Arbeit (siehe Schritt 2).
Dann sollten Unternehmen folgendes ermitteln: Wo liegen Lücken über fünf Prozent? Und lassen sie sich durch objektive Kriterien erklären?
Schritt 4: Gehaltsstrukturen anpassen
Wenn die Gap-Analyse Unterschiede von mehr als 5% aufzeigt, die nicht sachlich erklärbar sind, müssen Unternehmen innerhalb von sechs Monaten handeln und die Lohnlücke schließen oder rechtfertigen. Gelingt ihnen das nicht, müssen sie eine formelle „gemeinsame Entgeltbewertung“ mit dem Betriebsrat oder der Arbeitnehmervertretung durchführen.
Wichtig ist die Dokumentation: Sowohl bei Anpassungen als auch bei begründeten Unterschieden sollte festgehalten werden, welche Entscheidung getroffen wurde und warum.
Schritt 5: Prozesse für Auskunftsanfragen aufsetzen
Ab 2026 können Mitarbeiter jederzeit nach Vergleichsgehältern fragen. Unternehmen sollten daher festlegen, wer diese Anfragen bearbeitet – HR, Geschäftsführung oder eine andere Stelle – und ein Antwort-Template vorbereiten.
Schritt 6: Stellenanzeigen anpassen und Teams schulen
Ab Mitte 2026 müssen Gehaltsinformationen im Bewerbungsprozess transparent gemacht werden – entweder in der Anzeige oder spätestens im ersten Gespräch. Unternehmen sollten ihre Vorlagen für Stellenanzeigen rechtzeitig überarbeiten und das Recruiting-Team schulen:
- Welche Informationen müssen genannt werden,
- Welche Fragen sind erlaubt, welche nicht?
Eine wichtige Änderung: Ab 2026 darf nicht mehr nach dem aktuellen Gehalt der Bewerbenden gefragt werden.
Häufige Fragen zur Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes
Betrifft das Entgelttransparenzgesetz auch kleine Unternehmen unter 100 Mitarbeitern?
Ja. Auch kleinere Unternehmen müssen Gehaltsinformationen in Stellenanzeigen angeben und auf Auskunftsanfragen von Mitarbeitern reagieren. Die Berichtspflicht über den Gender Pay Gap gilt erst ab 100 Mitarbeitern – aber das Transparenzgebot gilt für alle.
Was passiert, wenn wir das Reporting für das Entgelttransparenzgesetz nicht schaffen oder der Gender Pay Gap über 5 Prozent liegt?
Wenn Sie die Berichtspflicht nicht erfüllen, drohen Sanktionen. Wenn Ihr Gap über 5 Prozent liegt und nicht objektiv begründbar ist, müssen Sie eine Entgeltbewertung durchführen und einen Aktionsplan entwickeln.
Kann ich beim Entgelttransparenzgesetz einfach sagen, dass Gehaltsunterschiede leistungsbasiert sind?
Nein. Sie müssen objektive, nachvollziehbare Kriterien dokumentieren. „Der ist einfach besser“ reicht nicht. Sie müssen konkret machen können, worin diese Leistung messbar besteht – zum Beispiel höhere Verantwortung oder nachweisbare Zusatzqualifikationen.
Meine ehrliche Einschätzung: Das Gesetz ist ein Eingriff – aber Wegschauen wird teuer
Ich will ehrlich sein: Das neue Entgelttransparenzgesetz ist ein massiver Eingriff in unternehmerische Entscheidungen. Viele Mittelständler haben jahrelang Gehälter verhandelt – mal nach Gefühl, mal nach Budget, mal nach Verhandlungsgeschick. Jetzt müssen sie komplexe Strukturen schaffen, objektive Kriterien definieren und regelmäßig berichten. Das bedeutet Aufwand, das bedeutet Kosten.
Aber – und das ist der entscheidende Punkt – die Umsetzung der EU-Richtlinie kommt auch nach Deutschland. Unternehmen haben keine Wahl. Die Frage ist nicht ob, sondern wie sie sich darauf vorbereiten.
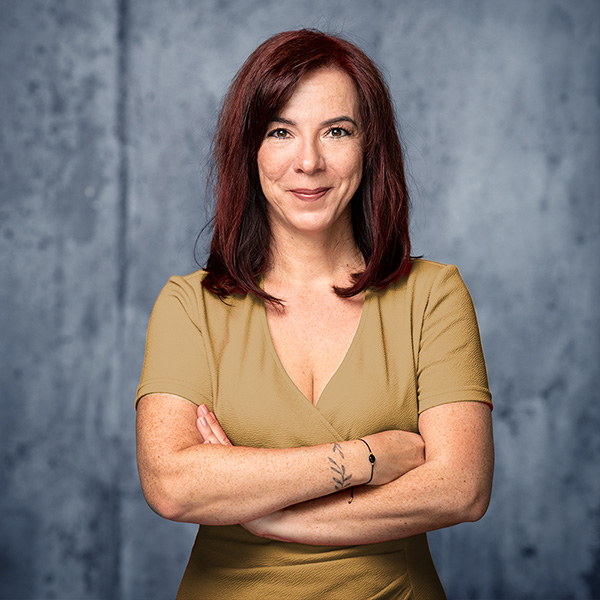
Wer jetzt anfängt, hat noch Zeit für eine strukturierte, durchdachte Vorbereitung. Wer wartet, wird 2026 unter Druck geraten – und dann wird es teuer. Bußgelder, Nachzahlungen, Konflikte mit Mitarbeitern, Imageschaden als unfairer Arbeitgeber. All das lässt sich vermeiden.
Für Mittelständler wird das ein Kraftakt, keine Frage. Aber wer jetzt beginnt, macht HR professioneller und seine Arbeitgebermarke stärker. Und das zahlt sich langfristig aus.
Meine klare Empfehlung: „Wir warten mal ab“ ist die schlechteste Option. Proaktive Vorbereitung ist günstiger als später Strafen zahlen zu müssen oder schnelle Korrekturen unter Zeitdruck zu erledigen.
